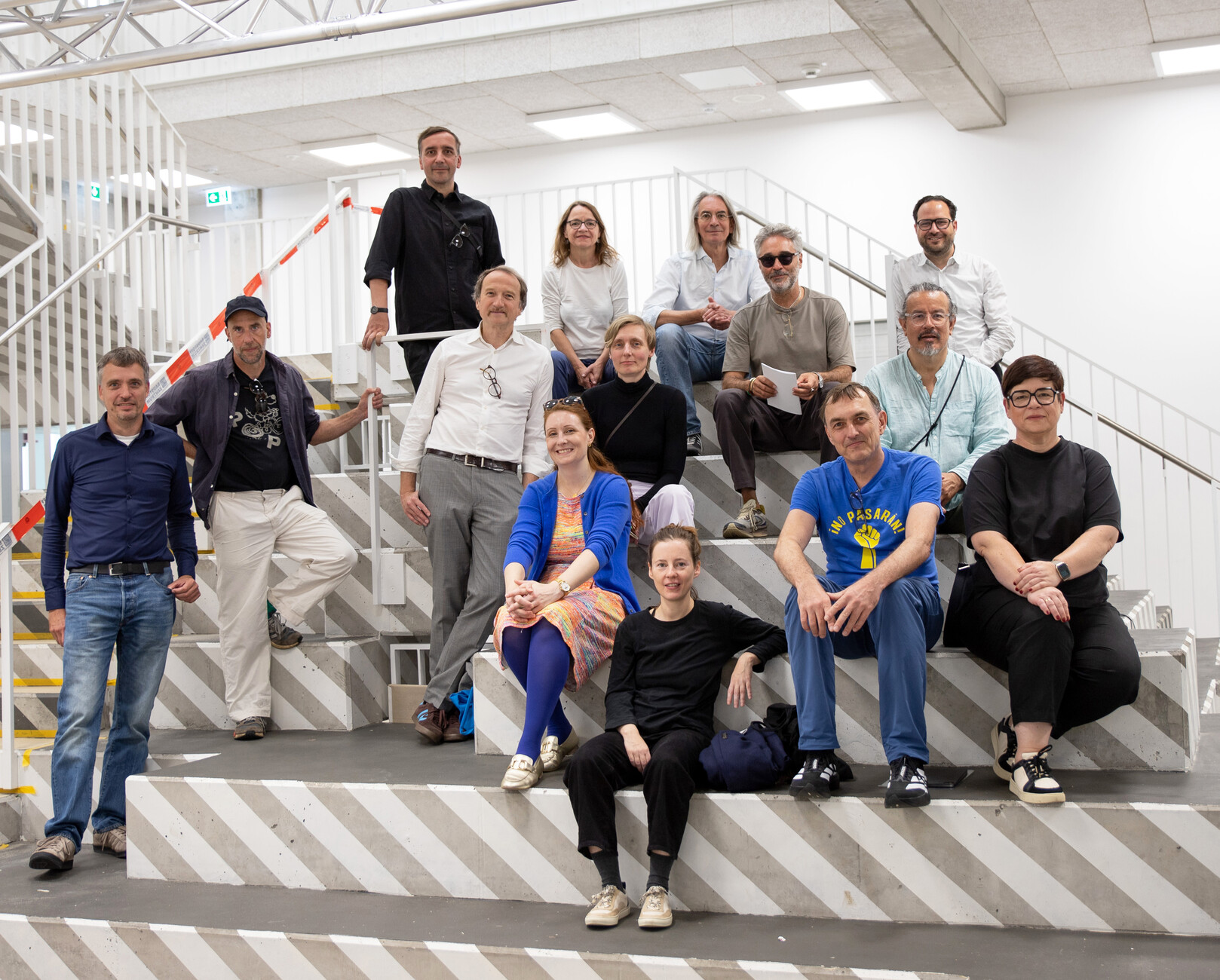DAM Preis 2026: Finale!
München: etal. – "Das robuste Haus"
Das "robuste Haus" steht im Stadtteil Ramersdorf/Perlach. Ein energieeffizientes Mehrgenerationenhaus von etal., das dank seiner ungewöhnlichen Fassade in der Görzer Straße 128 bereits auf den ersten Blick die Neugierde weckt: Inmitten von geradlinigen Neubauten, zurückhaltenden Mehrfamilienhäusern und dem historischen Bestand samt giebelständigen Satteldachbau, strecken sich drei Geschosse in die Höhe. Dessen vertikale Holzschalung aus Fichte wird nur von Fenstern, Türen sowie Stahltrapezblechen unterbrochen. Leicht nach vorn ausgestellt, wirken letztere wie mediterrane Markisen und dienen als Wetterschutz, denn unter ihnen sind grüne Holzrollos angebracht. Nur am oberen Ende befestigt, können sie flexibel bewegt und gewartet werden. Generell sind alle Gebrauchselemente so ausgewählt, dass die MieterInnen diese möglichst eigenständig warten und pflegen können. "Ursprünglich hätten wir uns vorstellen können, dass das gesamte Gebäude in recyceltes Stahltrapezblech gehüllt wird. Die Baugruppe wollte aber, dass sich der Holzbau nach außen in Holz zeigt. Wir haben uns für eine heimische alpine Fichte entschieden, die langsam gewachsen eine bessere Qualität mit sich bringt als viele heimische Lärchen. Das geschah auch aus optischen Gründen, denn die Fichte ergraut schneller und einheitlicher. Die Stülpung ist möglich, da es sich um Gebäudeklasse 3 handelt und wir keine Brandriegel benötigen. Sie ist ein einfaches Mittel das Hirnholz der Bretter zu schützen. Insgesamt hat das Haus eine ehrliche Ästhetik, die wir bewusst eingesetzt haben, und wir sind gespannt darauf, wie es altert.", so Elena Masla, die gemeinsam mit Zora Syren und Gesche Bengtsson das Architekturbüro leitet.
Holz, Stahl und offene Konstruktionen prägen den Bau mit einer Bruttogrundfläche von 930 Quadratmetern auch im Inneren vom Keller bis zum Sparrendach. Jedes der oberirdischen Geschosse bietet ein Cluster mit gemeinschaftlichen und privaten Räumen in wohngemeinschaftsähnlichen Einheiten. Im Untergeschoss befindet sich eine Waschküche, eine Werkstatt und ein Hobbyraum. Pro Etage gibt es sieben gleich große Flächen mit circa 18 Quadratmetern, deren Nutzung nicht vorbestimmt ist. Die aktuelle Raumanordnung kann so zukünftig an "Sollbruchstellen" verändert werden, wie an den Stürzen oder Schwellen. Das Wissen um die Optionen, die die Grundstruktur bietet, bleibt bestehen. Außer einer Fußbodenheizung wurde so wenig Technik wie möglich im Haus verbaut. Der Boden ist schlicht der leicht geschliffene und geölte Zementestrich, die unbehandelten Holzdecken sind sichtbar. Für das barrierefreie Wohnen ist ein Aufzug integriert, der bis auf das Untergeschoss in einem Holzschacht läuft. Rückseitig wurden Balkone mit Gitterrosten installiert.
Vor dem Haus blüht ein Wildgarten, an der Fassade sind Nistkästen angebracht. An der Eingangstür hängt ein gelber Zettel mit der schwarzen Aufschrift "Nie wieder Vermieter – Mietshäuser Syndikat", dazwischen eine Strichzeichnung von Häusern, in dessen Mitte eines ein Smiley-Gesicht hat. Das Projekt ist aus einem Konzeptverfahren der Stadt München hervorgegangen, auf das sich die Baugruppe zusammen mit dem Mietshäuser Syndikat beworben hatte. Mit einer Prise Anarchie und einem guten Schuss Optimismus haben die Architektinnen von etal. mit der Görzer128GmbH ein Modellprojekt für eine faire Wohnungspolitik in München entwickelt, das auf Gemeineigentum und Flexibilität basiert. Mit gemeinschaftlichen Wohnformen wird dieses langfristig bezahlbaren Mietwohnraum bieten, und das in der teuersten Stadt Deutschlands. Soll eines der Häuser des Syndikat verkauft werden, müssten alle anderen Häusergemeinschaften diesem Vorhaben zustimmen, somit wird eine nachträgliche Privatisierung weitestgehend vermieden. "Durch die Ausschreibung waren einige Parameter festgelegt – zum Beispiel, dass das Gebäude Clusterwohnungen enthalten und mit einem Mindestanteil von Holz gebaut werden musste. Dadurch konnten wir das Gebäude trotz Kostendruck als Holzrahmenbauweise umsetzen. Wir hatten bereits in Leipzig mit dem Mietshäuser Syndikat zusammengearbeitet. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass wir den Zuschlag für das Projekt erhalten haben.", erklärt Gesche Bengtsson.
Der Neubau in der Görzer Straße gehört der Görzer128GmbH, ist sozial gefördert durch die Stadt München und finanziert mit einem weit verzweigten Netz aus etwa 110 Direktkrediten und Standard-Bankdarlehen. Gut drei Millionen hat das Projekt gekostet, etwa 460 Euro Kaltmiete zahlen nun die aktuell 13 BewohnerInnen jeweils, mit Ausnahme des Kindes, das zu einer der Familien gehört. Ein Traumpreis in Zeiten von Wuchermieten und knappen Wohnraum, der aber mit einer großen Anzahl an ehrenamtlichen Arbeitsstunden balanciert wird: Während der Planungs- und Bauphase wurden für jeden Aufgabenbereich Gruppen gebildet und auch nach der Fertigstellung erfüllt jede der MieterInnen eine Aufgabe für die Hausverwaltung. Die hohe Selbstbeteiligung und Verantwortung aller für das Gelingen des Projekts stärkt die Identifikation mit dem Haus. "Das besondere an unserem Projekt ist, dass es ein Haus ist, das für die Zukunft gebaut ist, für flexible Wohnformen, das vielfältig umbaubar und bewohnbar ist.", so Zora Syren. Die Gemeinschaftsräume im Untergeschoss lassen sich teils zusammenlegen und sind wie der Garten auch für die Nachbarschaft eine Anlaufstelle, sei es für gemeinsame Feste, Werkstattnachmittage oder ein solidarisches Landwirtschaften. Ein offenes Haus, das Raum bietet für gleichberechtigtes Wohnen, Partizipation und viele Lebensentwürfe. "Wir können keine Häuser mehr kaufen, das ist zu teuer. Bis zu 320 Euro pro Quadratmeter in der Münchner Innenstadt ist kein sozial verträgliches Wohnen mehr. Was wir aber können, ist unser eigenes Ding machen", so Peter Niedersteiner, einer der Bewohner.
München: Hild und K – Übernachtungsschutz Lotte-Branz-Strasse
Der Bus bringt uns in den Münchner Norden nach Schwabing-Freimann in die Lotte-Branz-Straße. Hild und K Architekten haben im Industriegebiet einen Neubau errichtet, der obdachlosen Personen als temporärer Übernachtungsschutz dient. Parallel ist eine medizinische Versorgung und eine Beratungsstelle auf dem Gelände untergebracht. Zeit und Budget waren knapp bei der Planung, denn neben den Auswirkungen der Pandemie stand die Bayernkaserne im Jahr 2020 vor der Schließung, die in München bislang schutzsuchenden Menschen als Anlaufstelle diente. Die beiden Bauaufgaben Unterkunft und medizinische Einrichtung menschenwürdig gestalten sowie in Holzhybridweise nachhaltig bauen, das waren zwei der Ziele von Hild und K für dieses außergewöhnliche Projekt. Statt wie bislang große Schlafsäle, sollten kleinere Räume mit Metallspinden und Stockbetten für zwei, vier und acht Personen entstehen. Ebenso waren speziell ausgestattete Zimmer für körperlich eingeschränkte Personen wie getrennte Bereiche für Männer, Frauen und Familien gefragt. Hinzu kommen geschützte Außenanlagen, Gemeinschafts- und Einzelräume. Haustiere dürfen in die Räume mitgebracht werden, eine seltene Erlaubnis in öffentlich-rechtlichen Unterkünften.
Eine Raumzellenbauweise mit Containern, wie sie nur unweit des jetzigen Gebäudes zu finden ist, war für das Architekturbüro keine Option. "Es ist zu hinterfragen, ob wir aufgrund des Zeitdrucks wirklich dermaßen temporär bauen sollten. Es gibt zudem Überlegungen, dass das Gewerbegebiet sich wandeln wird, da es eine sehr wichtige städtische Lage ist. Das heißt, wir wollten einen Baustein entwickeln, der langfristig ein Teil dieser Struktur wird und damit eine Präsenz als städtisches Gebäude hat. Ein Bauen für den Bestand.", so Matthias Haber. Stattdessen entschied sich das Team für ein serielles Bauen: Ein Beton-Skelettbau bot die Basis für die viergeschossige Struktur, die möglichst robust sein sollte. In der kammartigen Aufteilung sind einzelne "Gebäudefinger" versetzt zueinander angeordnet und nur in den Eckbereichen verbunden. Es gibt einen zentralen Hof und kleinere Höfe mit Sitzgelegenheiten. Die Eingangsbereiche wurden mit einer Pergola-Struktur versehen, die den Bau nach vorne und zur Seite jeweils öffnet. Die Gestaltung ist typologisch an das historische Ledigenheim Theodor Fischers angelehnt. "Die Bauweise soll es ermöglichen durch einfachen Rück-, Um- und Weiterbau flexibel auf mögliche Zukunftsszenarien, wie Nutzungsänderungen, zu reagieren.", so Matthias Haber, der zur Geschäftsführung von Hild und K zählt. Über dem Sockelbereich aus Betonfertigteilen ist die aufgehende Fassade aus ziegelrot gestrichenen, vorgefertigten Holzrahmenelementen aufgebaut. Profilierte Bretter bewahren nun das empfindliche Hirnholz vor der Witterung. Für die Bordüre unterhalb der Attika haben sich Hild und K von schützenden "Opferbrettern" historischer Holzgebäude inspirieren lassen, die nach einigen Jahren zu ersetzen sind. Mit dieser Ornamentik und in Kombination mit teils runden Bullaugenfenstern wirkt der Bau für seine Funktion ungewohnt schmuckvoll. Die Photovoltaik auf den Gründächern gewährleistet indes eine nachhaltige Energieversorgung. "Das Besondere an diesem Projekt sind die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Aufgabe ist, für obdachlose Menschen ein Wohnen zu schaffen, das nicht Wohnen sein darf. Eine Atmosphäre, eine Aufenthaltsqualität, für die es einen Bedarf gibt und geben wird", so Haber.
Die Innenräume wurden neutral gestaltet und vorwiegend mit Holz, Linoleum, Keramikfliesen und geschliffenen Estrich ausgestattet. Das Ziegelrot der Fassade wiederholt sich in der Farbgebung einiger der Fenster- und Türrahmen. Eine Abteilung weiter sind die Türen petrolfarben gehalten. Farbige Akzente bieten darüber hinaus in jedem Bereich die barrierefreien Piktogramme auf gelben Schildern, die die Nutzung der Räume erklären und der Orientierung dienen. Jeder der langen Flure endet an einem Fenster, in den oberen Stockwerken sind Dachfenster eingelassen. Damit die Trennung zwischen den Bereichen stets gehalten werden kann, sind die größeren Fenster mit schmalen Gitternetzen versehen. Die Gänge sind hell, es riecht nach Desinfektionsmittel. Insgesamt 730 Personen haben in dem Bau nun Platz. Tagsüber ab neun Uhr werden die Zimmer für die Reinigung geschlossen, dann gibt es einen Tagestreff mit einer Grundversorgung. "Seit Mitte 2024 ist das Gebäude inzwischen in Betrieb. Die Härteteste laufen derweil und das Gebäude wird sehr gut angenommen", resümiert Matthias Haber.
Köln: Aretz Dürr Architektur – Wohnen F // 9
Eine modulare Nachverdichtung gegen alle Widerstände haben Aretz Dürr Architekten in der Kölner Südstadt zwischen Jakob- und Josephstraße geschaffen, und das ist wörtlich zu nehmen. Denn Hürden gab es viele. An dem engen Hinterhof-Grundstück, umringt von Gebäuden und einem Parkdeck hatte sich zuvor bereits ein anderes Architekturbüro vergeblich versucht. 2018 reichten Sven Aretz und Jakob Dürr ihren Baueintrag für "Wohnen F//9" ein und starteten von einem leeren Tisch aus eine neue Idee. Die Geduld der Beteiligten sollte in den folgenden fünf Jahren dann gehörig auf die Probe gestellt werden: So gut wie jede für den Bau relevante Verordnung wurde im Lauf verändert, sei es die Landesbauverordnung, die Holzbaurichtlinie oder die Stellplatzverordnung. Letztere war wichtig, da als Bedingung für die Baugenehmigung die Integrierung von acht PKW-Stellflächen gestellt wurde. "Auf der einen Seite die Auflagen der Stadt, diese Stellplätze nachweisen zu müssen, auf der anderen Seite der fehlende Wille der später Nutzenden, auf einen eigenen Stellplatz zu verzichten: beides führt dazu, dass Architektur zu solchen Maßnahmen greift und die Baukosten entsprechend durch die Decke gehen", so Sven Aretz. 2020 kam die Pandemie, 2022 begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, dessen wirtschaftliche Effekte sich wie Dominosteine auf das Projekt kippten. Die Stadt Köln zeigte den beiden Architekten derweil, wie geduldig Papier sein kann. Nach bis zu fünf Überarbeitsschleifen innerhalb des Genehmigungsverfahrens, einem Mobilitätsgutachten und einem Brandbrief an die Behörden lag sie dann endlich im Briefkasten: Die Baugenehmigung. "Das Besondere ist das Projekt steht in der Stadt in einem Hinterhof, in einer engen Bebauungssituation. Es ist eine Nachverdichtung in modularer Holzbauweise, ohne Stahlbetonbodenplatte, unterlüftet. Es war eine Herausforderung planungsrechtlich wie konstruktiv in der Erdbebenzone Zwei. Das ist für jeden Holzmodulbau eine Herausforderung, aber ich denke es ist uns gelungen. Den Hof haben wir nachverdichtet, wie zu zwei Drittel entsiegelt und begrünt.", so Aretz Dürr.
Wer heute auf dem Grundstück steht, ahnt nichts von den zurückliegenden Herausforderungen. Die Struktur des Gebäudes ist luftig, die Parklifte sind unter dem Vorplatz im Boden versenkt und können auf je zwei Etagen eindrucksvoll nach oben ausgefahren werden. Aretz Dürr Architekten haben die gut 25 Meter breite Baulücke in nur zehn Tagen mit einer eleganten Struktur gefüllt, die aus 32 vorgefertigten Holzmodulen besteht, die jeweils drei Meter breit sind. Um den Bodenaushub so gering wie möglich zu halten und für eine gute Querlüftung, ist das Gebäude auf pfahlgegründeten Streifenfundamenten aufgebockt. Die nach Osten zweigeschossigen und nach Westen dreigeschossigen Holzmodule sind jeweils um Stahlprofile ergänzt, mit denen Terrassen und Balkone geschaffen wurden. Sieben Wohnungen, die jeweils zwischen 38 und 90 Quadratmetern Wohnfläche bieten, sind entstanden. Die gewünschte Grauwassernutzung scheiterte leider an den umfangreichen Auflagen, wie an den nicht abgedichteten Kellergewölben aus dem letzten Jahrhundert unter den Nachbargrundstücken. Die geforderte Begrünung löste das Duo indes mit einer großzügigen Rasenfläche auf der Terrasse der Dachwohnung. "Architektur kann immer nur so gut sein wie die Regeln, die sie einhält.", sagt Jakob Dürr. Lachend erinnert er sich daran, wie sie in der Leistungsphase fünf gerade noch verhindern konnten, dass ihre offene Raumstruktur durch Trockenbau verkleidet wurde. "Wir stoßen jeden Tag an Grenzen. Aber es macht schon Spaß, wenn man weiß, dass man Lösungen findet", so Sven Aretz.
Dank dem Modulbau waren die meisten Oberflächen bereits vorgefertigt, für den Boden setzte das Duo zwecks Schallschutz auf einen konventionellen Estrich. Die Holzwände sind mit einem Pigmentanteil in Weiß lasiert, was den Vorteil hat, dass die Räume mit wenigen Möbeln wohnlich wirken. Viel Licht fällt durch die breiten Fensterfronten in diese von allen Seiten geschützte Oase inmitten dem Gewirr der Stadt. "Wohnen F//9" ist logisch konstruiert, mit minimalem Einsatz von Material und ermöglicht etwaige Um- und Neunutzungen. Es ist ein bislang fehlendes Puzzleteil auf einem eng bebauten Grundstück, das individuelle Lebensräume schafft und harmonisch an die Baukörper der Nachbarschaft anschließt.
Berlin: Peter Grundmann Architekten: ZK/U Zentrum für Kunst und Urbanistik
Im Ortsteil Moabit angekommen, laufen wir eine kurze Strecke zum Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs nahe der Siemensstrasse, das nach dessen Stilllegung zum Stadtgarten umgebaut wurde. Teil des 1.600 Quadratmeter großen Bürgergartens ist seit 2012 das Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) vom Künstlerkollektiv Kunstrepublik, das eine Verbindung zwischen künstlerischer Praxis, Stadtforschung und dem Alltag der Stadt schaffen will. Um dem wachsenden Interesse an dem Kulturangebot und dem generellen Raumbedarf in der Hauptstadt gerecht zu werden, brauchte es eine Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes. Sichtbar in die Jahre gekommen und nach zahlreichen Zwischennutzungen verfiel dieses zusehends. Hier kam Peter Grundmann ins Spiel: "2016 war der Startschuss für die Idee, den Bestand auszubauen. Ende 2018 gab es ein erstes Beteiligungsverfahren, das vor allem über das Quartiermanagement, also über den Bezirk, gelaufen ist, um die AkteurInnen aus der Stadtgesellschaft wie nahen Nachbarschaft in die Entstehung dieses Ortes miteinzubeziehen. Das war ein mehrstufiger Prozess und die anschließende Ausschreibung hat Peter Grundmann gewonnen.", so Elisa Georgi, Sprecherin des ZK/U. Um zum zentralen Kommunikations- und Ankerpunkt für das Quartier zu werden, sollte der Bestand energetisch saniert und räumlich ausgebaut werden. Peter Grundmann und sein Team erstellte die architektonischen Grundlagen: Er entschied sich dafür, das Dach der einstigen Lagerhalle zu entfernen, die Wände und Decken aber zu nutzen. Der Anbau setzt auf diesen auf, umhüllt sie teils, so dass die Ziegel in ihrer ursprünglichen Form erhalten werden konnten, inklusive dem Graffiti, was sich dort über die Jahre gesammelt hatte. Entlang dem alten Gemäuer wurde viel Raum für die Lüftungsanlage ausgehoben, ein Stahlgerüst aufgestellt und die Fachwerkträger aufgesetzt, die es ermöglichen, dass es einen stützenfreien Raum gibt. "Die Glasfassade war sehr teuer, da sie fünf Meter Windlast aufnehmen musste", sagt Peter Grundmann. Um die Fassadenrahmen kleiner zu halten, wurden im Selbstbau verstärkende Diagonalen integriert. Die Fassade dient nun als thermischer Schutz und ermöglicht die ganzjährige Nutzung der alten Industriehalle, die zuvor unbeheizt war. Zudem lässt die offene Struktur aus Glas und Stahl den Blick auf den Charakter des Ursprungsbaus frei.
In Zunfthose und mit dem Zollstock in der Hand, führt uns der Architekt über das Gelände in den Keller, in dem noch die gemauerten Rundbögen des Altbaus zu sehen sind und eine Eventfläche mit Bar entstanden ist. Anschließend geht es zur multifunktionalen Veranstaltungsfläche im Erdgeschoss, die mit Falttüren im Sommer geöffnet werden kann, quer durch die weitläufigen Räume im ersten Stock zu den außenliegenden Stahltreppen und hinauf aufs Dach. Als begehbare Terrasse gedacht, stehen dort Beuten mit Bienenvölkern, und in Hochbeeten wachsen große Pflanzen. Zum Nutzungsvertrag für das ZK/U gehört die Pflege des Geländes, von der Müllentsorgung bis zum Gärtnern. Auf der Rückseite des Baus öffnet sich die weite, öffentliche Parkfläche, der Blick schweift zu den historischen Bauten am Westhafen, in der Ferne fährt kaum hörbar eine S-Bahn vorbei. Einst verlief der Bahnsteig des Güterbahnhofs am heutigen ZK/U. "Das besondere an unserem Projekt ist, dass wir hier mit einer sehr heterogenen Bausubstanz gearbeitet haben, so dass sich neu und alt auf vielfältige Art überlagern", so Peter Grundmann. 3.300.000 Euro, inklusive Mittel der EU (EFRE) hat das Projekt benötigt, eine Mischung aus Fonds für regionale Entwicklung, auf Quartiers- bis EU-Ebene. Viele Arbeiten hat das Team selbst erledigt und – typisch für Peter Grundmann – die ein oder andere ungewöhnliche Lösung gefunden.
Die Struktur wirkt an manchen Stellen roh, fast provisorisch und bildet doch in sich eine Einheit mit industriellem Charme. Man darf die Übergänge sehen vom Bestand zu neuer Struktur und in die offenen Räume blicken. Die Architektur zeigt die Flexibilität und den Laborcharakter auf, den das ZK/U bietet, in dem die Räume jederzeit neu aufgeteilt werden können, um sie individuell zu nutzen. Zahlreiche Events werden an diesem urbanen Treffpunkt veranstaltet. Gleichfalls bieten die 2.000 Quadratmeter des ausgebauten Güterbahnhofs großzügige Workshopflächen wie temporäre Arbeits- und Wohnräume für 14 internationale KünstlerInnen und StadtforscherInnen mit einer Größe von 32 bis 53 Quadratmetern. Die Bewerbung auf die forschungsbezogene Residenzen mit einer Dauer von zwei bis acht Monaten ist über einen Open Call jedes Jahr möglich. "Wir sind Projektraum und Artist in Residency. Die Idee ist, internationale Gäste und Themen mit lokalen Personen wie Kursen zu verbinden. Einen Transferraum zu bieten, was der Bahnhof früher war. Wir haben ein großes Interesse daran, wie sich Communities bilden und wie man Communities verbindet.", so Elisa Georgi. Es ist ein Bau für die Gesellschaft und Gemeinschaft geworden, mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck und einer zeitgemäßen Architektur, die über die folgenden Jahre an den Bedarf des "Wir" angepasst werden kann.
Berlin: PPAGarchitects ztgmbh – Doppelschule Allee der Kosmonauten
Raus aus dem Trubel der inneren Stadt fahren wir in den Bezirk Lichtenberg an das nördliche Ende des Landschaftsparks Herzberge im Berliner Osten. Hier ist die Doppelschule "Allee der Kosmonauten" entstanden, die eine Integrierte Sekundarschule (ISS) und ein Gymnasium kombiniert. "'Die Allee der Kosmonauten' ist ein Schulbau in der Schulbauoffensive der Stadt Berlin, ein Pilotprojekt. Eines der ersten das fertiggestellt wurde, und das neben anderen Anforderungen die zeitgemäße Pädagogik berücksichtigt. Es ist eine Compartmentschule, das heißt neue Unterrichtsformen werden berücksichtigt und sind prototypisch in der Architektur zu sehen.", so Georg Poduschka, geschäftsführender Gesellschafter von PPAG architects. Die Compartments bilden quasi kleine Schulen innerhalb des Gebäudes und sind gleichberechtigt um das Zentrum angeordnet, in denen die gemeinschaftlichen Flächen liegen. Um Energie zu sparen, verfügt jedes Compartment über eine eigene Lüftungsanlage, die nur nach Bedarf genutzt wird. Statt dem gängigen Konzept der "Flurschule" zu folgen, wird die jahrgangs- und klassenübergreifende Zusammenarbeit in überschaubaren Gemeinschaften gefördert: Die Räume können je nach Bedarf möbliert werden, um klassenübergreifende Lernlandschaften zu schaffen. "Gemeinsam lernen" ist der Leitgedanke.
2019 gewann PPAG Architects den Architekturwettbewerb für den Neubau der Schulanlage mit einem Entwurf in Holz-Hybridbauweise. Nur wenige Monate später wurde mit dem Rückbau von acht Bestandsgebäuden, dem Austausch des Bodens und dem Umverlegen von Fernwärme- und Wasserleitungen begonnen. 2021 erfolgte die Grundsteinlegung. Seit 2024 ist der Bau auf 28.000 Quadratmetern erstellt, das gesamte Grundstück ist 37.000 Quadratmeter groß. Auf fünf Geschossen gehen nun Sekundarschule, Gymnasium und zwei Dreifachsporthallen ineinander über. Gut 1.600 Schülerinnen und Schüler haben in dem Gebäude Platz, dazu kommen etwa 200 LehrerInnen und Lehrer. Eine klassische Aula gibt es nicht, dafür zwei Mehrzwecksäle, die zusammengeschaltet werden können. Darüber hinaus bietet das Erdgeschoss mit einer 900 Quadratmeter großen Piazza viel Raum für eine Nutzung, die je nach Bedarf angepasst werden kann. Kleine Stufenpyramiden aus Beton sind Treffpunkte nahe der Treppenhäuser im Erdgeschoss. Der ungewöhnliche Bau soll bereits von außen Neugierde wecken: viele Elemente sind abstrakt gehalten, wie die Hängesitze aus schwarzem Kautschuk an Stahlketten, die in unterschiedlichen Höhen im Eingangsbereich angebracht sind. Den Schülerinnen und Schülern stehen zahlreiche Freizeitangebote zur Verfügung, wie eine Skateanlage, eine Lehrküche oder ein Fußballfeld. Die farbigen Akzente sind im Außenraum auf wenige Beispiele beschränkt, wie den kirschroten Gestellen der Tischtennisplatten oder den Überdachungen der Fahrradständer, dessen Form an die geometrischen Körper im Sandbox-Computerspiel Mindcraft erinnert: Gruppen von farbbeschichteten Stahlkonstruktionen mit Pyramidendach reihen sich in verschiedenen Grüntönen auf. Im Innenraum schlängeln sich währenddessen breite Metallstreifen dynamisch durch die Lichtschächte bis zu den Dachfenstern und die Stahlstruktur entlang der Treppen ist je nach Bereich zur Orientierung in einer Farbe lackiert, wie Gelb, Blau und Grün.
Noch ist das weitläufige Areal wenig belebt, da die Fertigstellung nicht lange zurückliegt. In der Bibliothek stehen keine Bücher, die Mensen haben noch nicht geöffnet. "Diese Schulen brauchen etwa sechs bis sieben Jahre, bis ein Normalbetrieb herrscht", erklärt Poduschka. Der Start der Belegung erfolgt erstmal nur mit den Klassen des siebten Jahrgangs. Der Takt wird in den nächsten Jahren vom Modell des Ganztagsaufenthalt bestimmt werden, der den SchülerInnen einen Arbeits- und Lernraum wie Lebensraum bietet. Die Fertigstellung der Ausbildungsstätte erfolgte hingegen zügig: Der Rohbau dauerte dank vieler Fertigteile nur neun Monate, der Aufbau der beiden Sporthallen war jeweils nach sechs Tagen erledigt. Geradlinig wirkt der massive Stahlbetonskelettbau mit einer Leichtbaufassade aus Holzriegelbau von innen wie von außen und zeigt industriellen Charme. "Bildungsbauten müssen im Grunde die Kathedralen des 21. Jahrhunderts sein", so Georg Poduschka.

Die Bekanntgabe des Preisträgers und Verleihung des DAM Preis 2026 sowie die Eröffnung der Ausstellung mit dem Preisträgerprojekt und allen Bauten der Shortlist finden am 30. Januar 2026 im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main statt. Zu diesem Anlass erscheint auch das Deutsche Architektur Jahrbuch 2026 mit ausführlichen Besprechungen der Bauten aus der Shortlist und des Preisträgers.
AUSSTELLUNG:
31. Januar – 3. Mai 2026
im Deutschen Architekturmuseum (DAM)
Schaumainkai 43, 60314 Frankfurt am Main
PREISVERLEIHUNG + AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG:
Freitag, 30. Januar 2026, 19 Uhr