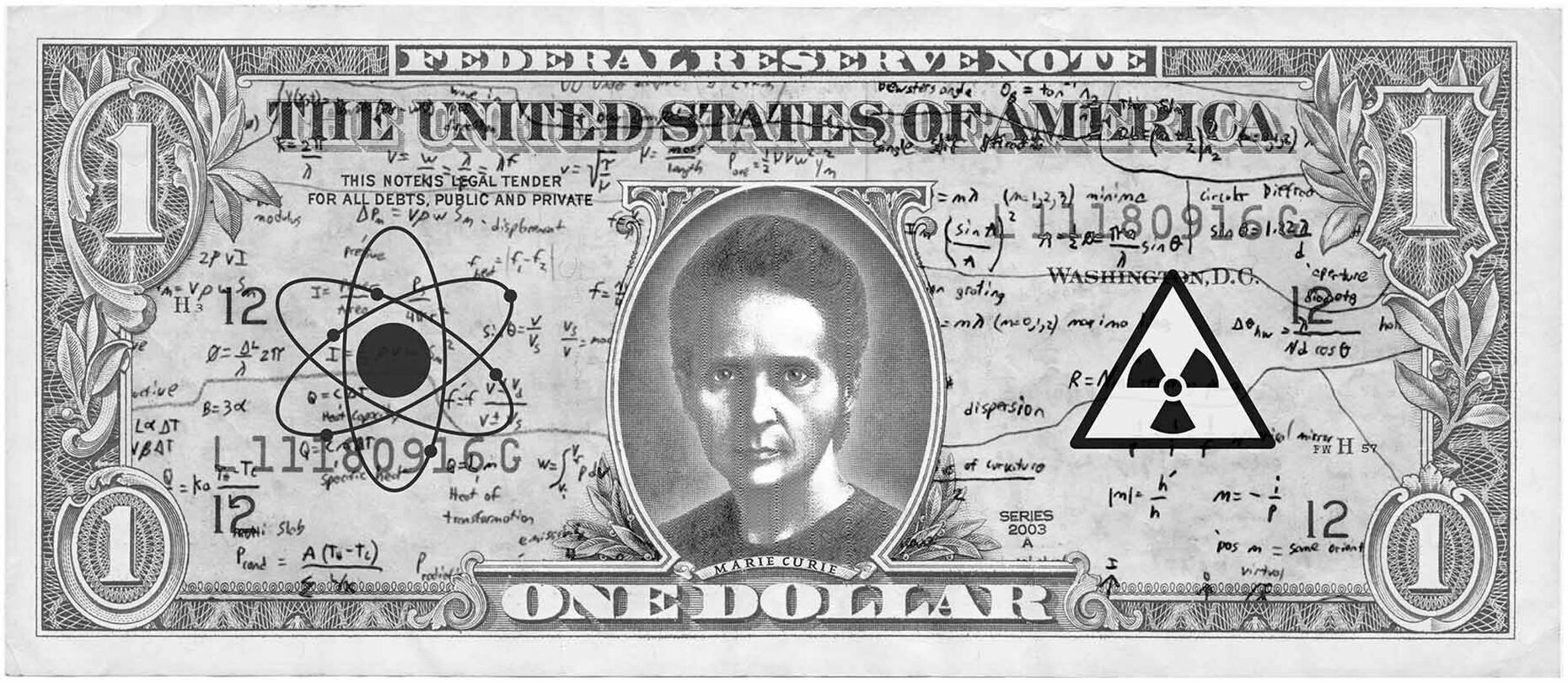Der feine Unterschied
Anna Moldenhauer: Von 1995 bis 2015 waren Sie Professorin für Gender und Design / Designforschung an der Köln International School of Design. Ihre Forschung begann bereits in einer Zeit, als es den Begriff Gender noch nicht gab und eher von "Frauenangelegenheiten" die Rede war. Was hat Sie an dem Thema gereizt?
Dr. Uta Brandes: Um die Frage ein wenig anekdotisch zu beantworten – als ich in Hannover mit dem Studium begann, habe ich auch an den studentischen Protestaktionen teilgenommen. Unter den SprecherInnen war nur eine Frau. Sie hielt das Megafon und redete frei, ohne Zettel, ohne Angst. So wollte ich auch werden, sie war quasi mein erstes Vorbild. Im Fach der Psychologie an der Leibniz-Universität Hannover stellte unsere Professorin Regina Becker-Schmidt, eine ehemalige Assistentin des Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno, zudem regelmäßig neue Forschungsideen vor. Ein aktueller Schwerpunkt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hatte den Titel "Integration der Frau in die Berufswelt". Heute reicht das nur noch für einen Witz, aber damals war es das erste Mal, dass überhaupt eine Art "Frauenprogramm" angeboten wurde. Wir haben dann einen Forschungsantrag eingereicht – der thematische Fokus waren Industriearbeiterinnen. Dieser wurde bewilligt und noch ungefähr acht andere Projekte. In der Jury saßen überwiegend konservative Personen, die jeden Ansatz in Richtung Feminismus skeptisch betrachteten. Wir AntragstellerInnen haben uns aber nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern eine Solidarität entwickelt, die uns gemeinsam vorangebracht hat. Bei einem Vortrag als wissenschaftliche Mitarbeiterin hat mich später Rita Süssmuth, die damalige Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit angesprochen, da sie in Hannover ein Institut mit dem Titel "Frau und Gesellschaft" leiten sollte. Sie hat mir kurz darauf die Bereichsleitung für das Institut ermöglicht. Das Thema Gender war also von Anfang an auf der Agenda und hat mich auch in den späteren Stationen nicht mehr losgelassen.
Sie haben als Pionierin sehr viele Plattformen zur Diskussion über Gender und Design geschaffen, die es bis dato nicht oder nur selten gab. Begriffe wie das "Non Intentional Design" wurden von Ihnen in die Designforschung eingeführt. Warum gab und gibt es diese Leerstellen in der Branche?
Dr. Uta Brandes: Mich hat das auch sehr verwundert, denn als ich mit der 1995 als Professorin berufen habe, gab es in vielen anderen Fächern bereits Genderlehrstühle, wie in der Literatur, Romanistik oder der Biologie. Das Thema war dort bereits akademisch verankert, im Design hingegen überhaupt nicht. Das habe ich nicht verstanden, denn Design hat sehr viel mit unseren geschlechtlichen Beziehungen zu tun. Wir sind umgeben von Design, leben in und mit Design, ob wir es wollen oder nicht. Die "alten weißen Männer", alles ausgewiesene, erfolgreiche Designer, sagten zu dieser Zeit, dass Design nichts mit Gender zu tun habe. Es gehe stattdessen um Funktionalität und Anmutung, die sei objektiv und neutral. Wenn Studierende Fragen zum Thema Gender hatten, wurden sie an mich verwiesen, mit dem Hinweis, ich würde etwas "mit Frauen" machen. Gender bedeutet aber bekanntlich nicht "Frau". Ich habe auch Anfragen von Unternehmen bekommen, die etwas "für die Frauen" bieten wollten. Der Hauptteil der Arbeit bestand dann darin, denen zu erklären, dass es nicht darum geht, schlicht die Formen der Produkte runder oder die Farben pastelliger zu wählen, um Kundinnen anzusprechen. In der Zwischenzeit hat sich zum Glück eine Menge verändert, auch wenn es immer noch nicht ganz einfach ist.
Wenn Sie heute Unternehmen zum Thema Gender und Design beraten, verstehen diese nun, dass sie von einer Diversität im Design profitieren können?
Dr. Uta Brandes: Die Ergebnisse, die wir gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet haben, fanden viele der Unternehmen sehr originell, aber eine entsprechende Anpassung des Produktionsprozesses erfolgte meistens nicht. Die aktuell sichtbaren Veränderungen finden heute eher über die Kampagnen von Marketing und Werbung ihren Weg in die Unternehmen, denn die Personen dort haben die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Gender auseinanderzusetzen, schneller verstanden.
Vielleicht haben diese Abteilungen außerdem verstanden, dass sich ein Engagement im Bereich Gender und Design finanziell lohnen kann.
Dr. Uta Brandes: Genau das.
Ihre Studie "Frauenzimmer im Hotel – Wie Geschäftsfrauen sich Hotels wünschen" finde ich sehr interessant. Denn obwohl inzwischen viele Geschäftsreisende weiblich sind, werden deren Bedürfnisse bei der Ausstattung der Hotelzimmer meist nicht berücksichtigt.
Dr. Uta Brandes: Im Austausch mit den HotelbetreiberInnen zeigten sich schnell Missverständnisse, was es an Investment braucht, um gendergerechtes Design anzubieten, à la "wir können es uns nicht leisten, auf gehobene Ansprüche von Frauen einzugehen". Ich weiß nicht, ob die jetzt dachten, Frauen wollen goldene Armaturen haben – stattdessen geht es um eine offene, klügere Gestaltung, so dass die Zimmer leicht anpassbar an jede Person sind. Die Männer, die wir während der Studie gefragt haben, was ihnen bei dem Aufenthalt in einem Hotelzimmer wichtig ist, haben meist drei Dinge aufgezählt, die Frauen hingegen bis zu 37. Ganz praktische Sachen, die vermutlich auch Männer nicht perfekt finden – wie das Neonlicht in Kombination mit den Vergrößerungsspiegeln im Bad. Den Männern war das zwar nicht bewusst aufgefallen, aber ich denke, dass eine Veränderung der Beleuchtung für sie ebenso angenehmer wäre. Es geht bei Gender und Design nicht um eine Extrawurst für Frauen, sondern um fluide Gestaltung, die entsprechend den Bedürfnissen der Gäste individualisiert werden kann. Und wenn dann eine Farbe wie Rosa neben vielen anderen Farben gewünscht würde, wäre das o.k. – nur wenn die Gestaltung mit einem bestimmten Stereotypen verbunden ist, muss man dagegen angehen.
„Es geht bei Gender und Design nicht um eine Extrawurst für Frauen, sondern um fluide Gestaltung.“
Wenn wir nach jahrhundertelanger Einäugigkeit jetzt langsam lernen in der Gestaltung mit beiden Augen zu sehen – was braucht es im Feld Gender und Design am nötigsten?
Dr. Uta Brandes: Es gibt für das Thema Gender und Design weltweit immer noch zu wenig Professuren, die diesen Aspekt als Hauptbestandteil führen. Es braucht eine Art Schirmdisziplin, die bis zum Produkt wie in den Service und das Digitale hineinreicht. DesignerInnen müssen parallel aber auch mehr Mut aufbringen, ihre Ideen in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen klar zu äußern. Diese sollten im Gegenzug eine Basis bieten, um das Experiment mehr zuzulassen, statt sich vorwiegend damit zu beschäftigen, die Nachfolge von bereits bestehenden Produkten zu klären. Im Endeffekt spart ihnen der offene Dialog mit den DesignerInnen und der Mut zum Risiko auch Geld.
Eine Genderneutralität im Design kann es zudem nicht geben, sagen Sie.
Dr. Uta Brandes: Ja, das behaupte ich. Es gibt den Begriff "genderneutral", aber ich verwende den nie.
Was mir in der Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen der Branche oft begegnet, ist als Gegensatz zu einem vermeintlich "neutralem" Design die Unterteilung in "weibliche" und "männliche" Formen. Machen wir uns die Kategorisierungen zu einfach?
Dr. Uta Brandes: Ja, wir machen es uns zu einfach. Diese Genderfragen sitzen tief, denn wir alle sind mit den Zuschreibungen für männlich und weiblich aufgewachsen. Es gibt Formen oder Farben, die in Gesellschaften automatisiert als eher typisch männlich oder typisch weiblich wahrgenommen werden. Und das wieder aus unseren Köpfen herauszubekommen ist ziemlich schwierig, selbst für mich. Wir sind gesamtgesellschaftlich kollektiv über Jahrhunderte erzogen worden, in "männlich" und "weiblich" einzuteilen. Mit dieser Sichtweise nehmen wir Einfluss auf die Art der Projekte und Produkte, auf die Auswahl der Farben und Formen, auf die Materialien et cetera. Das muss erstmal aus den Köpfen raus, damit man nicht automatisch sagt, eine helle Farbe sei "eher weiblich". Fritz Heidenreich hat beispielsweise 1950 für Rosenthal eine kleine Vase mit einer Ausbuchtung entworfen, die bekam die Werksbezeichnung "Schwangere Luise". Bei einer bauchigen Figur denkt man wohl zuerst an Schwangerschaft und nicht an einen Mann mit Bierbauch. Unsere Interpretationen, unsere Wahrnehmung der Welt sollten sich ändern. Selbst ich muss mich diesbezüglich immer wieder reflektieren, denn es gibt so viele Details, an denen wir Geschlecht festmachen, auch das biologische Geschlecht. Sich davon zu lösen, ist schwer, und den Unternehmen geht es dabei natürlich nicht besser. Ich habe aber mit Blick auf die junge Generation Hoffnung, da sie sich der Identitätsfrage performativ und spielerisch nähert. Sie ist mutig, unterschiedliche Identitäten auszuprobieren, abseits einer bipolaren Geschlechtlichkeit. Je mehr das bei den Jüngeren passiert, umso eher wird sich etwas im Gesamtbild verändern, da bin ich ganz optimistisch.
Sie haben im Rahmen Ihrer Ausbildung und Lehre unter anderem New York, Shanghai und die Schweiz bereist – ist Ihnen dort ein anderer Umgang mit dem Thema Gender und Design begegnet?
Dr. Uta Brandes: Ich habe durchaus Unterschiede verspürt. An der Parson School of Design in New York City beispielsweise waren die Studierenden schon sehr viel weiter, sowohl in der Theorie wie in der Praxis von Genderthemen. Auch die selbstverständliche Aussprache von Feminismus war gängiger. Feminismus ist hierzulande ein Wort, das selbst DesignerInnen sich häufig immer noch nicht trauen zu verwenden. Ich habe also eine andere Akzeptanz von radikaleren Positionen im Bereich Genderforschung erfahren. Und das, obwohl meine Herangehensweise in den Workshops meist anders war als der Unterricht, den die Studierenden bislang gewohnt waren, denn ich habe sie raus "ins Feld" geschickt, anstatt am Schreibtisch Lösungen zu erarbeiten. Die Studierenden in China beispielsweise hatten tolle, experimentelle Ideen, obwohl sie noch nie mit dem Thema Gender und Design konfrontiert worden waren. In Japan hingegen sind viele der Jugendlichen sehr schrill in ihrem modischen Ausdruck, sehr radikal, viel mehr als in Europa. Eine gute Ausbildung nützt aber alles nichts, wenn man als GestalterIn das Wissen und Bewusstsein in der Zusammenarbeit mit Unternehmen nicht umsetzen kann. Da schimpfe ich manchmal mit den Jüngeren und sage ihnen, dass sie sich trauen müssen, mehr sein zu wollen als die ausführende Kraft.
In Ihrer Karriere haben Sie sehr gut gezeigt, wieviel man erreichen kann, wenn man mutig ist und auch mal eine radikale Entscheidung trifft, Verantwortung übernimmt. Was ich im Moment in der Branche wahrnehme, ist eine große Unsicherheit bei dem Thema Gender und Design. Haben wir zu wenig Mut gemeinsam Antworten zu finden?
Dr. Uta Brandes: Ich glaube die Unsicherheit ist auf jeden Fall da, seit es nicht nur um die Gleichberechtigung von Frauen geht, sondern ebenso um unterschiedliche Identitäten, um viele Geschlechter, teilweise selbstgewählte. Ein Beispiel: Wir, also der gemeinnützige Verein international Gender Design Network/iGDN, vergeben den iphiGenia Gender Design Award. In diesem Zuge haben wir eine Person ausgezeichnet, Gabriel Maher, die sich selbst als "non" identifiziert, also weder weiblich noch männlich. Die Ansprache auf Deutsch hat mir Schwierigkeiten bereitet, weil es im englischen die neutrale Einzahl "they" gibt, das "sie" hingegen ist im deutschen Mehrzahl und weiblich. Wenn ich da schon verunsichert bin und in alte Klischees verfalle, da mir die Sprache fehlt, wie soll es anderen Menschen gehen, die sich weniger mit dem Thema auseinandersetzen? Ich finde es falsch, die Menschen in zu viele Scheibchen aufzuteilen, denn ich will ja gerade die Offenheit. Was mir im Diskurs oft fehlt, ist die Fähigkeit argumentieren zu können, andere Meinungen auszuhalten, mit Kritik umzugehen. Es gibt auch innerhalb der "Szene" viele unsinnige und der Sache schadende Auseinandersetzungen.
Sie beobachten gerne Menschen und ihre Gewohnheiten, um zu lernen, was in der Gestaltung fehlt – welche Gruppe beobachten Sie gerade?
Dr. Uta Brandes: Wenn ich im Alltag das Verhalten von Menschen beobachten will, komme ich nicht ohnehin, diese in Gruppen wie "männlich" und "weiblich" einzuteilen – und das ist ein Problem der Beobachtungsforschung, wenn es um Geschlecht geht. Daher bearbeite ich zur Zeit zwei andere große Themen: Körper und Stimme. Was passiert mit unseren Körpern in der Zukunft, gerade mit den technologischen und bio-chemischen Aufladungen? Von technologischen Implantaten über die Definition von Schönheit, bis zur Abgrenzung, ab wann etwas als eine Körperverletzung gilt – könnte das beispielsweise zukünftig der Diebstahl eines Smartphones sein, wenn wir darauf unsere wichtigsten Körperdaten speichern? In diesem Kontext forsche ich mit dem Fokus Gender, ob dort eine Demokratisierung einträten könnte oder es doch bei den Stereotypen verbleibt. Im Rahmen der Stimme finde ich interessant, dass für die Sprachsteuerung überwiegend Frauenstimmen verwendet werden. Darüber hinaus sind die Stimmen von Frauen in den letzten Jahren allgemein um einige Töne tiefer geworden. Die Ursache scheint nicht biologisch begründet zu sein, sondern darin zu liegen, dass Frauen nun in der Öffentlichkeit präsenter sind und wir sehr hohe Stimmen generell als unangenehm empfinden. Eine männliche, tiefe Stimme wird hingegen als vertrauenswürdig und die Person als kompetent wahrgenommen.
Interessant fände ich zudem, ab wann eine tiefe weibliche Stimme als negativ eingestuft wird.
Dr. Uta Brandes: Genau. Das geht auch andersherum, wenn Männer eine hohe Stimme haben, werden sie für bestimmte berufliche Positionen eher nicht besetzt. Allein an diesem Beispiel sehen wir, wie weit der Einfluss der Stimme reicht.
Gibt es eine Erkenntnis im Bereich Gender und Design, die Sie gerne zu einem früheren Zeitpunkt gehabt hätten?
Dr. Uta Brandes: Das ist eine schöne Frage, die ist mir noch nie gestellt worden. Ich denke, generell wäre es gut gewesen, wenn schon früher eine Ausweitung des Begriffes "Mann" und "Frau" passiert wäre. Das hätte einfach einen größeren Horizont eröffnet. Ansonsten fällt mir das auf Anhieb schwer zu sagen, denn meine beruflichen Stationen waren sehr unterschiedlich und haben sich stets weiterentwickelt, wie ich mich in diesem Zuge ebenfalls. Daher bin ich mit der Berufsbiografie einigermaßen zufrieden, und denke nicht "schade, hätte ich mal".
Design wird meiner Ansicht nach im Gegensatz zur Kunst oder der Architektur von einem Großteil der Gesellschaft immer noch zu eng rezipiert. In der Vermittlung ist parallel oft von "Stil" die Rede, obwohl der Begriff der hohen Bedeutung von Design für unser Leben nicht gerecht wird. Warum ist das so?
Dr. Uta Brandes: Das ist wirklich ein Phänomen. In der Tat werden die Kunst und Architektur anders betrachtet, als Design gelten eher verrückte und teure Objekte. Vielleicht liegt es daran, dass Design alltäglich ist, von der Tasse über den Laptop bis zur Sanitärausstattung. Es war gefühlt "schon immer da", man schaut nicht bewusst darauf. Aufmerksamkeit bekommt es erst, wenn es sehr teuer ist oder besonders ausgefallen, dann zählt es als "Designerobjekt". Alles andere ist zu viel Normalität. Mode dagegen wird zwar auch unter Design gefasst, aber dort kann mehr experimentiert werden als in anderen Bereichen. Sie dient somit weiteren Disziplinen als Inspiration.
Daher finde ich umso wichtiger, dass es Personen wie Sie gibt, die bereits in der Lehre vermittelt haben, dass eine schnelle Einordnung nicht ausreicht. Wie blicken Sie auf die Zukunft des Themas Gender und Design?
Dr. Uta Brandes: Meine ehemaligen StudentInnen tragen das Thema weiter – wie Prof. Dr. Gesche Joost, die heute Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin ist und das Design Research Lab leitet, oder Prof. Dr. Tom Bieling, Designforscher und Professor für Designtheorie an der HfG Offenbach. Es ist ein harter und langer Weg, aber mit Blick auf meine Alumni
bin ich optimistisch.